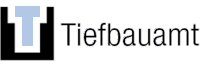Die Untersuchung ist Bestandteil des deutsch-niederländischen Interreg-Projektes "Zuwanderer integrieren". Prof. Dr. Dietrich Thränhardt übergab die Arbeit jetzt Jochen Köhnke, dem Dezernenten für Aussiedler-, Flüchtlings- und Asylbewerberangelegenheiten der Stadt. Die Studie trägt den Titel "Vergleichende Evaluation lokaler Programme in Münster und Enschede". Sie kann in Münsters Stadtnetz im Internet abgerufen werden: www.muenster.de/stadt/zuwanderung (Rubrik "Interreg-Projekt").
Die Politikwissenschaftler haben elf Indikatoren festgelegt, die den Verlauf von Integration messbar abbilden. Dazu gehören neben Arbeit, Sprache und Bildung insbesondere das Wohnen und der Umfang von Kontakten und Beziehungen von Zuwanderern zur einheimischen Bevölkerung. Die Stadt Münster, die gemeinsam mit dem niederländischen Enschede das binationale Interreg-Projekt ins Leben gerufen hat, wollte vor allem wissen: Unterscheidet sich der Verlauf der Integration von Aussiedlern, die das herkömmliche Eingliederungsverfahren durchlaufen haben, vom Ergebnis der Arbeit mit Integrationslotsen?
Integrationslotsen treffen gemeinsam mit jedem Zuwanderer eine individuelle, für beide Seiten verbindliche Vereinbarung über die Schritte, die unternommen werden, damit die Migranten hier Fuß fassen und heimisch werden können. Dazu gehört auch die Unterstützung bei der Suche nach einer Erstwohnung in einem gewachsenen, nicht "segregierten" Wohnquartier, wo die Zuwanderer an ein Geflecht von Nachbarschaften, Vereinen, Kirchengemeinden, Sport-, Kultur- und Freizeitangeboten "andocken" können.
Tatsächlich konnten 93 Prozent der Zuwanderer, die von einem Integrationslotsen begleitet wurden, ihre erste Wohnung in einem nicht segregierten Stadtteil nehmen; im herkömmlichen Eingliederungsverfahren war das bei nur 40 Prozent der neu ankommenden Spätaussiedler der Fall. Schon für das zweite Jahr nach der Einreise sei der Erfolg des "Dreiklangs 'Lotsenarbeit - Netzwerk - Wohnen'" messbar, so Prof. Dietrich Thränhardt. Das zeigte sich bei den Integrations-Indikatoren Arbeit, unabhängige finanzielle Grundversorgung, Wohnen, Kontakt zu Einheimischen und "Wunsch nach Rückkehr". Voraussichtlich werde das die Dokumentation des Integrationsverlaufs für das jetzige dritte Jahr noch deutlicher bestätigen.
Dezernent Jochen Köhnke bedankte sich für die fundierte Untersuchung. Sie sei "praktiziertes Miteinander auf der Achse Universität - Stadtverwaltung". Die Studie belege, dass Münster mit dem neuen Integrations-Ansatz ohne finanziellen Mehraufwand deutlich höhere Erfolge erzielen könne. Köhnke: "Aus der weiteren Betreuungsarbeit wissen wir, dass die betroffenen Zuwanderer bislang an keiner Stelle sozial auffällig wurden. Das spricht für das Modell Münster."
Bildtext:
Prof. Dr. Dietrich Thränhardt (2.v.l.) und Politikwissenschaftlerin Marina Seveker überreichten Dezernent Jochen Köhnke (l.) und Projekt-Geschäftsführer Stephan Nover die Studie. - Foto: Presseamt Stadt Münster. Veröffentlichung honorarfrei.